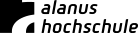Andreas Lischewski, Professor für Erziehungswissenschaft am Institut für Erziehungswissenschaft und empirische Bildungs- und Sozialforschung des
Fachbereichs Bildungswissenschaft, beschäftigt sich in einem aktuellen Forschungsprojekt mit der Frage, welche Parallelen es zwischen Pest und Corona gibt. Grundlage dafür ist ein Text des tschechischen Pädagogen und Theologen Johann Amos Comenius (1592-1670), der als Zeitzeuge vom Pestausbruch 1631 in der polnischen Stadt Lissa berichtet. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Zusammenstellung einer ersten kommentierten, zweisprachigen Ausgabe des Berichts, von welchem weltweit nur noch ein einziges Druckexemplar existiert.
Seit Ausbruch der Pandemie hält das Coronavirus die Welt in Atem – auch noch im Sommer 2021. Im Vergleich zu Epidemien und Pandemien vergangener Zeiten ist Covid-19 jedoch verhältnismäßig jung. Deutlich älter ist beispielsweise die Pest, die sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen lässt. Von der Antike, über das Mittelalter, bis in die Frühe Neuzeit bestimmten Pestwellen über Jahrhunderte immer wieder das Leben der Menschen – sehr selten und vereinzelt sogar noch heute.
Pestausbruch legt weltanschauliche Gräben offen
Einer dieser verheerenden Pestausbrüche ereignete sich 1631 im polnischen Lissa und wurde von Johann Amos Comenius schriftlich festgehalten. Besonders interessant am Pestilenz-Bericht ist laut Lischewski die intensive gesellschaftliche Auseinandersetzung im Umgang mit Pesterkrankten. Übertragen auf die Corona-Krise ergeben sich hierbei spannende Überschneidungen, wie er in einem Artikel des General-Anzeigers Bonn berichtet: „Comenius gerät in eine Kontroverse, die erstaunliche Parallelen zu dem hat, was wir heute diskutieren.“ Diese Kontroverse wurde von zwei sich gegenüberstehenden Meinungen geführt, ergänzt der Erziehungswissenschaftler. Auf der einen Seite argumentierten die Menschen aus einer medizinisch-hygienischen Sicht und forderten ein strenges abtrennen der Erkrankten in Unterkünften außerhalb der Stadt, um ein weiteres ausbreiten der Krankheit zu verhindern. Auf der anderen Seite berichtet Comenius von einer theologisch-humanistischen Sichtweise, welche die medizinisch-hygienische Ansicht scharf kritisierte: „Sie haben gesagt, wir dürfen die Menschen nicht wegsperren, wir müssen sie pflegen und dafür sorgen, dass sie Lebensmittel und Ärzte bekommen“, erläutert Lischewski die Ausführungen von Comenius.
Geschichtsschreibung hilft im Umgang mit Corona
Lischewski betont, dass die Darstellungen von Comenius einer umfassenden Quellenanalyse kaum standhalten können, zumal sich in Lissa keine Streitigkeiten dieser Art nachweisen lassen. Dennoch spiegeln sie eine historisch durchaus weit verbreitete Problemlage wider. Viele Theologen der damaligen Zeit machten die Allmacht Gottes für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich und hielten eine strikte Trennung von Gesunden und Kranken daher für ein ungeeignetes Mittel, um die Pest einzudämmen. Zu diesen gehörte auch Comenius, der sich damit gegen die Auffassung der meisten Mediziner stellte, dass vor allen Dingen Reinlichkeit und Abstandswahrung zu einer Eindämmung der Seuche beitrage könnten. Die tatsächliche Ursache der Pest kannten hingegen auch sie noch nicht; das Pestbakterium wurde erst 1894 entdeckt.
Ob korrekt wiedergegeben oder nicht: Aus dem Pest-Bericht von Comenius und dem Umgang der Menschen mit der Krankheit kann man für die Corona-Pandemie wichtige Lehren ziehen, betont Lischewski: „Wir sehen, dass Menschen aufeinander losgehen, weil sie unterschiedliche Auffassungen haben, wie man mit einer Pandemie umgehen solle, und ich glaube, dass die Geschichtsschreibung helfen kann, diese Mechanismen zu verstehen.“ Denn die heutigen Diskussionen um die Öffnung von Schulen, Kultureinrichtungen und Sportvereinen drehen sich immer noch um das gleiche Problem, das schon Comenius umtrieb: Wieviel Abstand der Menschen untereinander ist sinnvoll, ohne sie einer nicht mehr zu verantwortenden Isolation auszusetzen? Anders als Comenius werden wir auf diese Frage aber keine eindeutige Antwort mehr finden. Sie muss vielmehr gesellschaftlich immer neu ausgehandelt werden.